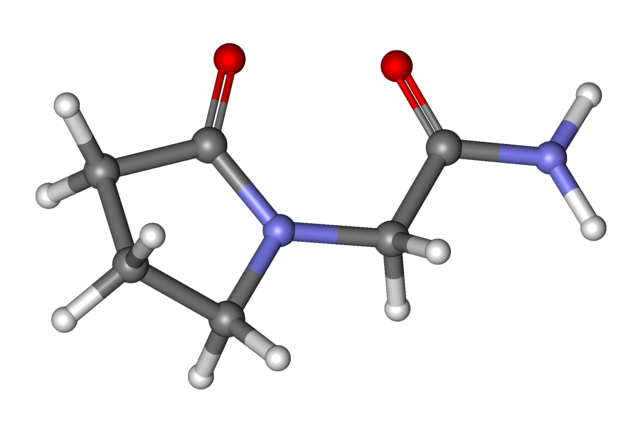Die Vergabe des Medizinnobelpreises an zwei deutsche Wissenschaftler zu Beginn dieser Woche rückt einen Forschungszweig ins Licht der Öffentlichkeit, der bisher trotz gewaltiger Fortschritte eher ein Schattendasein führte. Zwar hatte der amerikanische Kongreß die neunziger Jahre vollmundig zur „Dekade des Gehirns“ erklärt; für den Mann auf der Straße aber blieb diese Verlautbarung ebenso bedeutungslos wie millionenschwere Förderproramme der Bundesregierung oder er Europäischen Gemeinschaft.
Unterdessen fahren ganze Heerscharen von Wissenschaftlern damit fort, in mühseliger Kleinarbeit dem Gehirn seine Geheimnisse zu entwinden und die oft widersprüchlichen Ergebnisse wie Mosaiksteinchen zu einem gewaltigen Fresko zu verarbeiten. Für diese Minderheit in unserer Gesellschaft steht längst zweifelsfrei fest: Das „Ich“ hat einen Sitz im Gehirn.
Denken, Lernen, Vergessen, ja selbst Gefühle wie Freude und Schmerz, Angst und Hoffnung, Lust und Liebe erwachsen aus dem unendlich komplizierten Zusammenspiel mikroskopisch kleiner Einheiten. Die Rede ist von Nervenzellen (Neuronen), und die Tatsache, daß die Resultate der Neurowissenschaftler von so wenigen nachvollzogen werden können, rührt sicherlich auch daher, daß wir unser Gehirn tagtäglich zu Tausenden von verschiedenen Arbeiten heranziehen, ohne jemals über die ungeheure Leistung dieses Gebildes nachzudenken.
In unseren Köpfen tragen wir rund 100 Milliarden Nervenzellen mit uns herum (* die jüngste Schätzung sagt 86 Milliarden). Jede einzelne dieser Zellen hat Kontakt zu durchschnittlich 1000 Nachbarn, manche spezialisierte Neuronen pflegen sogar über 100.000 Beziehungen gleichzeitig. Summa sumarum kommt man somit auf rund 100 Billionen (100.000.000.000.000) Verbindungen (Synapsen) zwischen den grauen Zellen.
Die mikroskopischen Dimensionen dieses Netzwerkes erlauben es beispielsweise, eine Vielzahl von Funktionen wie den Gehörsinn, das Gleichgewichtsempfinden und den Richtungssinn in einem Raum unterzubringen, der nicht größer ist als eine Murmel. Töne, die nur wenige Tausendstelsekunden aufeinanderfolgen, können mit diesem Präzisionsinstrument noch unterschieden werden. Im empfindlichsten Hörbereich genügt eine Auslenkung des Trommelfells um wenig mehr als den Durchmesser eines Wasserstoffatoms, um ein Geräusch wahrzunehmen. In absoluter Dunkelheit reichen schon fünf Lichtteilchen (Photonen) aus, um vom Auge als Lichtblitz wahrgenommen zu werden.
All diese fantastischen Leistungen beruhen letztendlich auf der Funktion einzelner Nervenzellen oder von ganzen Netzwerken zusammengeschalteter Neuronen. Während man früher zu der simplen Gleichung tendierte Gehirn gleich Computer, weiß man heute, daß jedes einzelne Neuron einen kleinen Computer für sich darstellt. Eingehende Daten wie Licht, Schall oder ein Botenstoff des Körpers können von verschiedenen Spezialisten – den Sinneszellen – erkannt werden.
Die Daten werden gesammelt, auf ihre „Wichtigkeit“ überprüft und gegebenenfalls in Form eines elektrischen Reizes weitergeleitet. Nachgeordnete Nervenzellen, die Interneuronen, können mit ihren feinverästelten Armen, den Dendriten, diese Signale von bis zu 100.000 Nachbarn empfangen. Dann beginnt die Rechenarbeit: Treffen die elektrischen Reize gleichzeitig ein oder in kurzer Folge hintereinander? Ist das, was da gemeldet wird, wichtig genug, um den nächsten Neuronen auf der Befehlsleiter Meldung zu erstatten?
Wird letztere Frage mit ja beantwortet, so meldet die betreffende Zelle das Rechenergebnis weiter, indem über einen einzigen, großen Zellfortsatz, das Axon, wiederum ein elektrisches Signal abgesandt wird. Dabei werden Spitzengeschwindigkeiten von über 100 Metern in der Sekunde erreicht. Über mehrere Stufen wird so aus dem Rohmaterial der Daten das Wesentliche herausgearbeitet. Wie mit einem Filter wird ein Gesicht in einem Muster aus Hell und Dunkel erkannt, ein Wort aus dem Geräuschpegel herausgehört.
Noch erstaunlicher werden diese Leistungen, wenn man bedenkt, daß die Nervenzellen ja keine festgefügten Bausteine sind, sondern lebende Einheiten, die auf ihre Umgebung reagieren. Schon vor der Geburt bahnen sie sich ihren Weg durch die verschiedenen Gewebe, einmal angelockt und dann wieder abgestoßen von chemischen Botenstoffen oder dem Kontakt zu Gliazellen, die wie Fluglotsen den nur scheinbar chaotischen Verkehrsfluß regeln.
Diese Erkenntnisse sind nicht nur von theoretischer Bedeutung, sie schaffen auch die Voraussetzung für gezielte Eingriffe in die Biochemie des Gehirns. In dem Kinofilm „Zeit des Erwachens“ wird diese Möglichkeit dem Zuschauer drastisch vor Augen geführt. Der Neurologe Oliver Sacks, nach dessen authentischen Erfahrungen der Film gedreht wurde, erprobte im Jahr 1969 das Medikament L-Dopa an insgesamt 80 Patienten, die durch eine mysteriöse Nervenkrankheit an den Rollstuhl gefesselt waren und teilweise über Jahrzehnte stumm vor sich hin starrten.
Dank des L-Dopas wurden die völlig apathischen Patienten aus ihrer Trance geholt; allerdings dauerte dieses „Erwachen“ für die meisten nur einen Sommer. Heute weiß man, daß L-Dopa eine Vorstufe für einen der wichtigsten Botenstoffe des Gehirns (Dopamin) darstellt. Für Menschen, die an der Parkinsonschen Krankheit leiden, ist dies alles andere als trivial, denn durch das Verständnis dieser Vorgänge konnten neue Arzneimittel gezielt entwickelt werden.
Erklärtes Ziel vieler Forscher ist es, die Krankheiten des zentralen Nervensystems in den Griff zu bekommen. Ein bis zwei Prozent der Bevölkerung leiden beispielsweise unter Depressionen oder Schizophrenie, aber noch immer beruhen Therapieansätze vorwiegend auf Versuch und Irrtum. „Die bisherigen Eingriffe in das Gehirn gleichen dem Wurf einer Handgranate in eine Telefonzentrale“, meint einer der bekanntesten Hirnforscher Deutschlands, der Frankfurter Professor Wolf Singer.
(erschienen in „DIE WELT“ am 9. Oktober 1991)