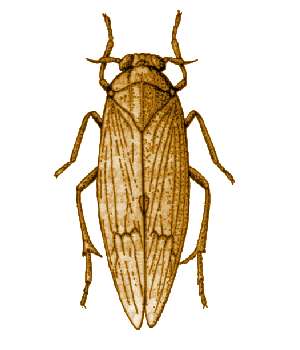Die Technik der Abfallverbrennung hat in den letzten zwölf Jahren rapide Fortschritte gemacht. Bei mehreren derzeit laufenden Müllverbrennungsanlagen bleibt die Konzentration der in den Abgasen freigesetzten Schadstoffe schon jetzt unter den Werten, die gemäß der 17. Bundesimmissionsschutzverordnung erst 1995 erreicht werden sollen. Diese Angaben machte Professor Hubert Vogg vom Kernforschungszentrum Karlsruhe (KfK) gestern vor der Wissenschaftspressekonferenz in Bonn.
Erfolge wurden demnach vor allem erzielt bei der Reduktion von Chlorwasserstoffen, Staub, Cadmium und Quecksilber, ebenso bei Dioxinen und der verwandten Stoffklasse der Furane. Bei allen Substanzen können mit verbesserten V erfahren die Emissionen auf mindestens ein Vierzigstel, im Falle des Dioxins sogar auf ein Vierhundertstel der Werte von 1980 gedrückt werden.
Beim Dioxin kamen den Forschem neue Erkenntnisse über die Entstehung des Seveso-Giftes. Dioxine und Furane, so fand man, bilden sich in den Abkühlzonen der Rauchgase bei Temperaturen zwischen 250 und 400 Grad Celsius in Anwesenheit von unvollständig verbranntem Kohlenstoff. Dies führte zu der Empfehlung, die Verbrennung strömungstechnisch sanfter und bei erhöhter Temperatur durchzuführen. Ein Ratschlag, der, so Vogg, „inzwischen von der Industrie voll in die Praxis umgesetzt wurde“.
Die Grenzwerte können jetzt unterboten werden
Noch vor zwei Jahren war kritisiert worden, daß der in der Bundesimmissionsschutzverordnung festgelegte Grenzwert utopisch und mit dem damaligen Stand der Technik nicht zu erreichen sei. In einem Kubikmeter Abgas darf danach ab 1995 nur noch ein zehnmilliardstel Gramm Dioxin (genauer Dioxintoxizitätsäquivalente) enthalten sei. Mittlerweile wird dieser weltweit strengste Richtwert in jeder zehnten der 50 westdeutschen Müllverbrennungsanlagen (MVA) unterschritten.
Diese Anlagen verarbeiten im Schnitt jeweils 200 000 Tonnen Hausmüll pro Jahr. In den neuen Ländern dagegen gibt es – mit einer Ausnahme – keine Hausmüllverbrennung. Stattdessen werden die gewaltigen Abfallmengen auf Deponien gelagert. Die Investitionen für eine MVA, die sich technisch auf dem neuesten Stand befindet, belaufen sich auf 80 bis 100 Millionen Mark.
Bei der Verbrennung von Hausmüll ergeben sich Probleme vor allem aus der weitgehend unbekannten Zusammensetzung der Abfälle. „Bei Hausmüll ist man vor Überraschungen nicht gefeit. Die Situation ist anders als beim Sondermüll, wo die Zusammensetzung in der Regel genau bekannt ist und die Verbrennung dementsprechend optimiert werden kann“, erläuterte Manfred Popp, Vorstandsvorsitzender des KfK.
Doch nicht nur die Abgase, sondern auch die in fester Form anfallenden Reststoffe stellen eine gewaltige Umweltbelastung dar. In Schlacken, Salzen und vor allem in Filterstäuben finden sich nämlich ein Großteil der Schadstoffe aus den häuslichen Abfällen wieder. Deren Anteil läßt sich mit einer chemisch-physikalischen Nachbehandlung verringern, die in Karlsruhe als 3R-Verfahren (Rauchgasreinigung mit Rückstandsbeseitigung) entwickelt wurde.
Trotz der Erfolge der letzten Jahre hegen die Karlsruher Wissenschaftler keine Zweifel an der Prioritätsreihenfolge „Vermeidung-Verwertung-Verbrennung“. In diesem Zusammenhang kritisierte Popp, daß derzeit einer ausgefeilten Produktionstechnik für alle Bedarfsgegenstände keine vergleichbare Verwertungstechnologie gegenüberstehe. Popp forderte ein stärkeres Engagement der Industrie auf diesem Sektor. „Es ist ein Armutszeugnis, wenn 70 Prozent aller Abfälle heute unbehandelt bleiben.“
Hier sieht der Vorstandsvorsitzende auch eine Chance für das KfK, das sich in Zukunft stärker auf den Gebieten Umweltforschung und Umwelttechnik engagieren will. Die Grundfinanzierung dieser größten deutschen Forschungseinrichtung war für das laufende Jahr deutlich reduziert worden.
(erschienen in „DIE WELT“ am 22. Januar 1992)
Anmerkung: Nach mehreren Umbenennungen ist aus dem KfK inzwischen das „Karlsruher Institut für Technologie“ geworden.