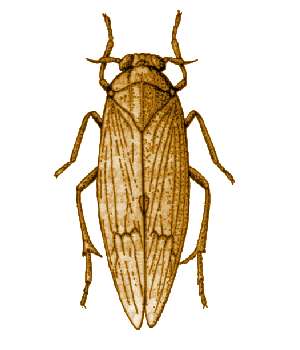Eine – nicht nur für Schweizer Verhältnisse – gewagte Ausstellung ist noch bis zum 3. November vor den Toren Zürichs zu bewundern. Auf 60.000 Quadratmeter Fläche präsentiert sich die Crème de la crème der eidgenössischen Wissenschaft. Rund 300 aktuelle Forschungsprojekte, von der Tiefbohrung über sprechende Maschinen bis zur Atmosphärenforschung, werden vorgestellt. Neben „harten“ Themen wie Mathematik und Physik gibt es nachdenkliche Beiträge zur Rolle der Naturwissenschaften in unserer Welt.
Geradezu abenteuerlich mutet die Architektur der Ausstellungsgebäude an: Ein achtteiliges Ringzelt, aufgespannt an ebenso vielen Masten, ähnelt dem Münchner Olympiadach. Vier der Masten sind begehbar, allerdings nur für schwindelfreie Besucher. Denen präsentiert sich Europas größte Zeltanlage.
Unter 46 Tonnen schweren Kunststoffs kann der wissenschaftlich interessierte Laie das Ergebnis einer einzigartigen Kraftanstrengung der gesamten Schweizer Forschungsszene bewundern: Über 1000 Personen aus öffentlichen Hochschulen und privaten Forschungsanstalten haben sich auf Anregung von Georg Müller bereit erklärt, jedem, der es möchte, ihre Arbeit zu erklären. Müllers Initiative ist es zu verdanken, daß die Heureka nach langem Tauziehen um die Baugenehmigung mit der Stadt Zürich doch noch zustande kam.
Erst Ende November 1990 konnte mit dem Bau begonnen werden drei Monate später als geplant. In einem Gewaltakt wurden dann bei Wind und Wetter waghalsige Montagen durchgeführt. Noch am Tage der Eröffnung wurde im Akkord gearbeitet. Ein guter Teil der Schwierigkeiten, mit denen die Heureka zu kämpfen hat, ist durch die anfangs zögerliche Haltung der Behörden begründet.
So gab es erst Ende August einen Ausstellungskatalog, in dem sämtliche Projekte verzeichnet sind. Damit hätten sich die Besucher, die zunächst eher spärlich erschienen, abfinden können. Was den Veranstaltern aber beißende Kritik einbrachte, war die peinliche Tatsache, daß ein Großteil der Ausstellungsgegenstände schon nach kurzer Zeit defekt war. Viele der Projekte zum „Anfassen und Selbermachen“ leiden darunter.
Dies ist besonders ärgerlich, weil immerhin ein Drittel der Gesamtkosten (mehr als 30 Millionen Franken) über den Eintrittspreis finanziert wird. Der schlägt denn auch mit saftigen 20 Franken zu Buche. Immerhin ein Drittel der Mittel kommt von der öffentlichen Hand, der Rest von der Industrie. Die lange Liste der Gönner reicht vom Aargauischen Elektrizitätswerk bis zu den Zürcher Ziegeleien, und auch die Nasa oder die sowjetische Tiblisi-Universität haben ihr Scherflein beigetragen.
Schon am Eingang wird der Besucher mit dem Prinzip vertraut gemacht, das den größeren Teil der Ausstellung prägt. Unbefangen erklimmt er ein montiertes Lawinenstützwerk. Schweift dann sein Blick zur Anzeigetafel, so kann er unversehens sein aktuelles (Über-)Gewicht ablesen. Für manchen Wissenschaftsfreund ist damit das Streben nach Erkenntnis bereits beendet.
Einer kleinen, aber umso wißbegierigeren Minderheit werden umfangreiche Erklärungstafeln angeboten. Dort ist unter anderem nachzulesen, daß die typisch Schweizer Konstruktion einen Druck von bis zu 80 Tonnen pro Quadratmeter aushalten kann. Auch die relativ simple Meßvorrichtung, die es erlaubt, ganze Schulklassen zu wiegen, ist mit Grafiken anschaulich erklärt.
In Zelt 1 drängen sich Schüler vor einem Lithophon. Das Musikinstrument enthält keinerlei elektronische Elemente, stattdessen sind dunkle Platten aus Serpentin auf Resonatoren montiert, die mit einer verstärkten Klaviermechanik angeschlagen werden. Nach anfänglichem Zögern spielt ein Schüler etwas holprig „Oh when the saints“.
Damit ist das Eis gebrochen, der nächste Besucher schwingt sich hinter das Lithophon und improvisiert munter vor sich hin. Bei einem Triller kommt der Zuruf aus Kindermund: „Machen Sie das noch einmal!“ Und jetzt erst kommen die ersten Fragen: „Wie funktioniert denn das?“
Immer wieder beeindruckt die Geduld, mit der selbst gestandene Professoren und hochkarätige Spezialisten die Fragen der Besucher beantworten. Auch kritischen Fragen gehen die Veranstalter nicht aus dem Weg: So reflektiert eine Projektgruppe aus Genf – Theologen, die gleichzeitig Physiker sind – über die Versuche der Wissenschaft, in die Schöpfungsgeschichte einzugreifen. Vier Studenten der Sozialwissenschaften untersuchen Entscheidungskriterien und Vorgänge bei Gen- und Fortpflanzungstechnologien.
Wer will, kann auf der Heureka mehr über Geschichte und Gegenwart der Forschung erfahren als in jedem multidisziplinären Studium. Der vielbeschworene Elfenbeinturm, in dem sich die Wissenschaftler nach landläufiger Meinung so gerne verstecken – hier ist er jedenfalls nicht zu finden.
(erschienen in „DIE WELT“ am 22. Oktober 1991)